|
|
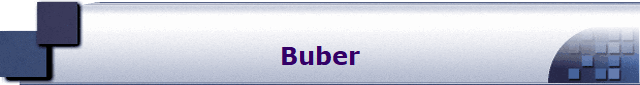 |
||
|
Die politische Dimension von Martin Bubers Philosophie Zitate aus dem Buch: Martin Buber – Das dialogische Prinzip (Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. Verlag Lambert Schneider, Gerlingen 1962, 7. Auflage 1994; insgesamt 324 Seiten mit 6 Kapiteln.)
Martin Buber war ein österreichisch-israelischer Religionsphilosoph und Humanist, geb. 1878 in Wien, gest. 1965 in Jerusalem. Bing: Buber argumentierte, dass wahre Begegnungen auf einer tiefen, persönlichen und respektvollen Interaktion basieren, anstatt auf einer oberflächlichen oder instrumentellen Kommunikation. In seinem zentralen Werk "Ich und Du" [= das 1. Kapitel des hier verwendeten Buches] untersucht Buber die verschiedenen Weisen, wie Menschen miteinander interagieren können, und betont die Bedeutung von Authentizität und Ganzheitlichkeit in den Beziehungen. Er glaubte, dass durch das dialogische Prinzip Menschen nicht nur miteinander, sondern auch mit dem ewigen Du (Gott) in Beziehung treten können. _________________________________________
Ich möchte die sozusagen politische Dimension von Buber herauszuarbeiten versuchen. Martin Buber kommt es prinzipiell auf das Gemeinschaftliche der Menschen an, insofern Menschen sich im Dialog befinden. – Ich bringe nun diverse Zitate, welches dieses Thema umkreisen. _____________________________________________
Das 1. Kapitel (Seite 7 bis 136) hat den Titel „Ich und Du“ - veröffentlicht 1923
<Solange die Liebe ‚blind‘ ist, das heißt: solang sie nicht ein ganzes Leben sieht, steht sie noch nicht wahrhaft unter dem Grundwort der Beziehung.> (S.20)
Hinweis: Es gibt in Bubers Darstellung der menschlichen Beziehung zwei von ihm so genannte ‚Grundworte‘: Ich-Du und Ich-Es.
Buber betont, dass wahres Leben und echte Beziehungen nur durch das Grundwort Ich-Du möglich sind ______________________________ <Im Anfang ist die Beziehung: als Kategorie des Wesens, als Bereitschaft, fassende Form, Seelenmodel; das Apriori der Beziehung; das eingeborene Du.> (S.31) Ich denke, dieses angeborene Apriori der Beziehung wurde von dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Erik H. Erikson und seiner Frau 1950 mit dem prägnanten Ausdruck ‚Urvertrauen‘ benannt und ist seitdem in die Pädagogik und Psychologie eingegangen. Siehe Näheres dazu hier. Und weiter Buber dazu: <Die erlebten Beziehungen sind Realisierungen des eingeborenen Du am begegnenden; daß dieses als Gegenüber gefaßt, in der Ausschließlichkeit aufgenommen, endlich mit dem Grundwort angesprochen werden kann, ist im Apriorie der Beziehung begründet.> (S.31) <Die Entwicklung der Seele im Kinde hängt unauflösbar zusammen mit der des Verlangens nach dem Du, den Erfüllungen und Enttäuschungen dieses Verlangens, dem Spiel seiner Experimente und dem tragischen Ernst seiner Ratlosigkeit.> (S.32)
Was ist hieran ‚politisch‘? Wenn man den typisch engen institutionsmäßigen Begriff des Politischen anwendet, so ist sowas bestenfalls Pädagogik, die aber nix entscheidendes mit Politik zu tun hat. Wenn man jedoch einen tieferen Blick in die Realität des Politischen wirft, so wird man sich fragen müssen, wieso gibt es so viele ‚Spießer‘ in den Industrieländern, welche für triftige Argumente nicht zugänglich sind und deshalb eine verheerende Rolle in der Politik, zumindest als Wähler, spielen? (Siehe dazu: Vernunftgebrauch und/oder Spießer und/oder Hermann Glaser: Spießer-Ideologie und/oder den Psychoanalytiker Maaz). Die Beantwortung dieser Frage hat meiner Meinung nach maßgebend mit dem trostlosen Schicksal des Urvertrauens in der Kindheit der Spießer zu tun. Ich verwende in dieser Darstellung den Terminus ‚Spießer‘ als Fachausdruck. D.h. nicht einfach nur als eine negative ‚umgangssprachliche‘ Bezeichnung für die folgende vergleichsweise harmlose – aber nicht gänzlich harmlose - Personengruppe im umgangssprachlichen Sinne: Bing: Ein Spießer ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Person, die als kleinbürgerlich, engstirnig und stark auf konventionelle Werte und Normen bedacht gilt. Spießer legen oft großen Wert auf Ordnung, Sicherheit und materielle Werte und neigen dazu, Neuerungen und Unkonventionelles abzulehnen. Der Begriff wird oft abwertend benutzt, um jemanden zu beschreiben, der wenig Toleranz gegenüber abweichenden Lebensstilen und Ansichten hat und sich stark an gesellschaftliche Erwartungen und Traditionen hält. ____________________________________ Dagegen gibt es die nicht so harmlose Personengruppe der Polit-Spießer. Ich nenne diese gefährliche Sorte Spießer „Polit-Spießer“, weil diese die gesellschaftlichen Verhältnisse gemäß ihrer eigenen Kaputtheit normieren wollen. Z.B. sind sie latent kriegslüstern; eine Latenz, die sich bei geeigneter Propaganda seitens extremer Polit-Spießer dann deutlicher manifestiert, wie man dies z.B. im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg (ab 2022) beobachten kann, indem etwa Leute, die für ernsthafte Friedensverhandlungen mit Russland eintreten (wie beispielsweise der Friedensforscher Daniele Ganser) in Deutschland offiziöserweise perhorresziert werden. Hermann Glaser benutzte meiner Ansicht nach den Ausdruck Spießer tatsächlich ebenfalls im Sinne von Polit-Spießer, als er ihn in seinem Buch von 1964 (1. Auflage) in Zusammenhang mit der Entstehung des Nationoalsozialismus brachte: Bing: "Spießer-Ideologie" von Hermann Glaser ist ein tiefgehendes Werk, das die geistigen Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts untersucht, die zur Entstehung des Nationalsozialismus führten. Glaser beschreibt, wie der deutsche Geist in dieser Zeit zerstört wurde und wie sich das Dritte Reich mit all seinem kleinbürgerlichen Muff und seiner grauenvollen Dynamik entwickeln konnte . ____________________________
<Geist ist nicht im Ich, sondern zwischen Ich und Du.> (S.41) Ich persönlich nannte das immer ‚Das gemeinsame Gehirn‘. D.h. in der Diskussion, im geistigen Austausch können sich kreative Ideen und Lösungen entwickeln. <Der Mensch lebt im Geist, wenn er seinem Du zu antworten vermag. Er vermag es, wenn er in die Beziehung mit seinem ganzen Wesen eintritt. Vermöge seiner Beziehungskraft allein vermag der Mensch im Geist zu leben.> (S. 41) Üblicherweise gehen die Leute in die Politik entweder mit fertigen Ansichten, oder indem sie fertige Ansichten übernehmen wollen. Insofern ist für echte Diskussionen normalerweise kein Raum. Es geht bei unterschiedlichen Ansichten in der Regel um praktische Fragen (um ‚Debatten‘), wobei dann höchstens lediglich die Standpunkte aufeinanderprallen, die dann per Abstimmung mehrheitlich entschieden werden. M.a.W. diese übliche Art der Politikmacherei ist grundsätzlich geistlos. Und hier Geist, also Theoriediskussion, hineinzubringen stößt mehrheitlich auf Unverständnis und wird als Privatsache abgetan. Dazu gehört auch die Vorstellung, dass Freundschaft (also achtungsvoller, echter geistiger Austausch) in der Politik nix zu suchen hat. Ja, es gibt sogar die ironischen Steigerungsformen: „Feind, Todfeind, Parteifreund“. Buber drückt dies etwas gedrechselt folgendermaßen aus: <Die Erfüllung dieses Sinns und dieser Bestimmung wird von dem Menschen vereitelt, der sich mit der Eswelt [siehe oben Bing], als einer zu erfahrenden und zu gebrauchenden abgefunden hat und nun das in ihr Eingebundene, statt es zu lösen, niederhält, statt ihm zuzublicken, beobachtet, statt es zu empfangen, verwertet.> (S. 41) Im speziellen Sinne Politisch wird Buber ab der Seite 46/47. Ich zitiere daraus nur ein Extrakt: <Nutzwille und Machtwille des Menschen wirken naturhaft und rechtmäßig, solang sie an den menschlichen Beziehungswillen geschlossen sind und von ihm getragen werden. (…) Wirtschaft, das Gehäuse des Nutzwillens, und Staat, das Gehäuse des Machtwillens, haben so lange teil am Leben, als sie am Geist teilhaben> (S. 51) Das ist ein wahres Wort gelassen ausgesprochen! Beispielsweise der NS-Staat war in der Tat prinzipiell geistlos – ja nicht nur das, sondern explizit geistfeindlich (vgl. Bücherverbrennung 1933). Peter Suhrkamp sprach 1947 auf dem Opernplatz in Berlin: „Die Flammen, die zuerst über den Bücherhaufen prasselten, verschlangen später im Feuersturm unsere Städte, menschliche Behausungen, die Menschen selbst. Nicht der Tag der Bücherverbrennung allein muß im Gedächtnis behalten werden, sondern diese Kette: von dem Lustfeuer an diesem Platz über die Synagogenbrände zu den Feuern vom Himmel auf die Städte.“ Im ‚Dritten Reich‘ bildeten die Polit-Spießer das Rückgrat, die innere Partei des totalitären Regimes bis zum Untergang in den Trümmern von 1945. (Siehe dazu ‚Ideologische Argumentationstricks‘ No.37): Das Zusammenwirken von naiv idealistischen mit verbrecherischen politischen Zielvorstellungen) Der unumschränkte Herrscher dieses Reiches war der Extrem-Polit-Spießer Hitler. Viele Nicht-Spießer (natürlich auch die pauschal verfemten Kommunisten und Juden) mussten entweder, bei Gefahr für Leib und Leben, ins Ausland emigrieren, oder im Inland in Deckung gehen (wie z.B. die Leute vom 20. Juli oder Friedrich Kellner) oder aber dem Regime möglichst gläubig praktisch dienstbar sein, (wie z.B. der berühmte Physiker Heisenberg oder der Militär Guderian). <Aber in den kranken Zeiten geschieht es, daß die Eswelt, nicht mehr von den Zuflüssen der Duwelt als von lebendigen Strömen durchzogen und befruchtet: - abgetrennt und stockend, ein riesenhaftes Sumpfphantom, den Menschen übermächtigt.> (S. 56) <Zentriert eine Kultur nicht mehr im lebendigen unablässig erneuerten Beziehungsvorgang, dann erstarrt sie zur Eswelt, die nur noch eruptiv von Weile zu Weile die glühenden Taten vereinsamter Geister druchbrechen.> (S. 57) <Aber die Welt des Du ist nicht verschlossen. wer mit gesammeltem Wesen, mit auferstandner Beziehungskraft zu ihr ausgeht, wird der Freiheit inne.> (S. 60/61) < - Wie aber möchte der die Gewalt aufbringen, den Alp beim Namen aufzurufen, dem selbst im Innern ein Gespenst hockt – das entwirklichte Ich? (…) Wie sammelt sich ein Wesen ein, das unblässig von der Sucht der abgelösten Ichheit im leeren Kreis gejagt wird? Wie soll einer der Freiheit innewerden, der in der Willkür lebt?> (S.61)
Hier nun eine Charakteristik des Extrem-Spießers, sein Leben in Täuschungen und Fiktionen (siehe als markante Beschreibung bei Guderian - ideologische Argumentationstricks No.43, Beispiel 4): <Das Eigenwesen dagegen schlemmt an seinem Sondersein; vielmehr zumeist an der Fiktion seines Sonderseins, die es sich zurechtgemacht hat. Denn sich erkennen bedeutet ihm im Grund zumeist: eine geltungskräftige und es selbst immer gründlicher zu täuschen fähige Selbsterscheinung herstellen und sich in deren Anschauung und Verehrung den Schein einer Erkenntnis des eigenen Soseins verschaffen; dessen wirkliche Erkenntnis es zur Selbstvernichtung – oder zur Wiedergeburt führen würde.> (S. 67) Ich identifiziere den Terminus ‚Eigenwesen‘ von Buber mit dem bekannteren Ausdruck ‚Spießer‘ und den Terminus ‚Person‘ von Buber entsprechend mit dem Ausdruck ‚Nicht-Spießer‘. (Beides verwende ich im Sinne von Fachausdrücken). - Interessant jetzt die Ansicht Bubers, dass es keine absolute Dichotomie zwischen Spießer und Nicht-Spießer gibt: <Es gibt nicht zweierlei Menschen; aber es gibt die zwei Pole des Menschentums. Kein Mensch ist reine Person, keiner reines Eigenwesen, keiner ganz wirklich, keiner ganz unwirklich. Jeder lebt im zwiefältigen Ich. Aber es gibt Menschen, die so personbestimmt sind, daß man sie Person, und so eigenwesenbestimmte, daß man sie Eigenwesen nennen darf. Zwischen jenen und diesen trägt sich die wahre Geschichte aus.> (S. 67/68) Das ist ein wichtiger Punkt: Zwischen dem Extrem-Spießer und dem harmlosen Spießer (Eigenwesen von Buber genannt) gibt es Abstufungen: etwa Extrem - Mittel (normal) – harmlos. Desgleichen beim Nicht-Spießer (Person nach Buber): voll und ganz Mensch – leicht geschädigter problematischer Mensch (z.B. mißtrauisch oder nicht genügend geistig eigenständig). Der leicht geschädigte, problematische Mensch kann durchaus auch (vor allem in Krisensituationen) Züge des Polit-Spießertums annehmen. Er kann sich beispielsweise einer links-extremistischen Gruppierung als ‚Mitläufer‘ anschließen oder an den Hitler-Kriegszügen (1936 Einmarsch Rheinland; 1938 Österreich, Sudetenland und Tschechoslowakei; 1939 Polen; 1940 Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Norwegen; 1941 Nordafrika, Jugoslawien, Griechenland, Sowjetunion) überzeugt und vielleicht sogar begeistert aktiv mitwirken. Nun gibt es eine interessante Stelle in Martin Bubers Lehre für Leute, die man später speziell bei oppositionellen Künstlern und Intellektuellen in kommunistischen Ostblock-Staaten als „Dissidenten“ bezeichnet hat. Bekannte Dissidenten aus dieser Zeit sind Andrej Sacharow, Alexander Solschenizyn, und Václav Havel: <Je mehr der Mensch, je mehr die Menschheit vom Eigenwesen beherrscht wird, um so tiefer verfällt das Ich der Unwirklichkeit. In solchen Zeiten führt die Person im Menschen und in der Menschheit eine unterirdische, verborgne, gleichsam ungültige Existenz – bis sie aufgerufen wird.> (S. 68) Auf solche Dissidenten trifft das folgende zu: <Der Geist kann die Eswelt durchdringen und verwandeln. Kraft seiner sind wir der Verfremdung der Welt und der Entwirklichung des Ich, sind wir der Übermächtigung durch das Gespenstische nicht ausgeliefert.> (S. 102)
Über Schein-Religiosität: <Wer die Welt als das zu Benützende kennt, kennt auch Gott nicht anders. Sein Gebet ist eine Entlastungsprozedur; es fällt ins Ohr der Leere. Er – nicht der ‚Atheist‘, der aus der Nacht und Sehnsucht seines Kammerfensters das Namenlose anspricht – ist der Gottlose.> (S. 109) ________________________________
Das 2. Kapitel (Seite 139 bis 196) hat den Titel „Zwiesprache“ – Erstdruck 1929
<Denn wo Rückhaltlosigkeit zwischen Menschen, sei es auch wortlose, gewaltet hat, ist das dialogische Wort sakramental geschehen.> (S. 143) <Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat. Monologisch lebend ist nicht der Einsame zu nennen, sondern wer nicht fähig ist, die Gesellschaft, in der er sich schicksalsmäßig bewegt, wesensmäßig zu verwirklichen.> (S. 167) <Aber Liebe ohne Dialogik, also ohne wirkliches Zum-Andern-ausgehen, Zum-Andern-gelangen und Beim-Andern-verweilen, die bei sich bleibende Liebe ist es, die Luzifer heißt.> (S. 169) < “Der Mensch“, sagt Wilhelm von Humboldt in seiner bedeutenden Abhandlung über den Dualis (1827) „sehnt sich auch zum Behuf seines bloßen Denkens nach einem dem Ich entsprechenden Du; der Begriff scheint ihm erst seine Bestimmtheit und Gewißheit durch das Zurückstrahlen aus einer fremden Denkkraft zu erreichen. (…)“> (S.178) <Nur wer den anderen Menschen selber meint und sich ihm zutut, empfängt in ihm die Welt. Nur das Wesen, dessen Anderheit, von meinem Wesen angenommen, ganz existenzdicht mir gegenüberlebt, trägt mir die Strahlung der Ewigkeit zu.> (S. 183) Nun wird es bei Buber regelrecht politisch – aus der damaligen Zeit (vor 1929) entstanden: <Die Kollektivität ist nicht Verbindung, sie ist Bündelung: zusammengepackt Individuum neben Individuum, gemeinsam ausgerüstet, gemeinsam ausgerichtet, von Mensch zu Mensch nur so viel Leben, daß es den Menschen befeure.> (S. 185) <Ohne Du, aber auch ohne Ich marschieren die Gebündelten, die von links, die das Gedächtnis abschaffen wollen, und die von rechts, die es regulieren wollen, feindlich getrennte Scharen, in den gemeinsamen Abgrund.> (S. 187) < (Und die Freiheit, die ich meine, wird ja auch von keiner neuen Gesellschaftsordnung hergestellt.) > (S. 193) __________________________________________
Das 3. Kapitel (Seite 199 bis 267) hat den Titel „Die Frage an den Einzelnen“ – 1936 Hauptsächlich setzt sich Martin Buber in diesem Kapitel mit Stirner und Kirkegaard auseinander. Bei dem nächsten Gedanken von Buber geht es um Max Stirner.
Bing: Er ist am besten bekannt für sein Hauptwerk "Der Einzige und sein Eigentum", das 1844 veröffentlicht wurde. In diesem Buch kritisiert Stirner die bestehenden sozialen, politischen und religiösen Institutionen und plädiert für eine radikale Form des Individualismus. Stirner argumentiert, dass jeder Mensch das Recht hat, sich selbst als das höchste Gut zu betrachten und alle anderen Institutionen und Ideologien zu hinterfragen, die diese Freiheit einschränken. __________________________________
< „Der Eigene … ist ursprünglich frei, weil er nichts als sich anerkennt“ und „Wahr ist, was Mein ist“ sind Vorformeln einer von Stirner in all seiner rednerischen Sicherheit ungeahnten Vereisung der Seelen. Aber auch manches starre kollektive Wir, das eine übergeordnete Instanz ablehnt, läßt sich leicht als eine Übersetzung aus der Sprache des Einzigen in die des nichts als sich allein anerkennenden Gruppen-Ich verstehn, (…)> (S.201) Das folgende dreht sich um Kirkegaard und dabei insbesondere um das Thema ‚Ehe‘ und ihre Bedeutung. <1843 trägt Kirkegaard in sein Tagebuch das unauslöschliche Bekenntnis ein: „Hätte ich Glauben gehabt, so wäre ich bei Regine geblieben.“ Damit will er sagen: Hätte ich wirklich geglaubt, daß “für Gott alles möglich ist“, also auch dies, meine Schwermut, meine Ohnmacht, meine Angst, meine schicksälige Fremdheit zur Frau und zur Welt zu lösen, so wäre ich bei Regine geblieben.> (S. 225/226) <Kirkegaards Denken kreist um das Faktum, daß er auf eine wesentliche Beziehung zu einem bestimmten Menschen wesentlich verzichtet hat.> (S.228) Buber nimmt Kirkegaards Problem zum Anlass, seine eigene Sichtweise der Ehe darzulegen: <Die Ehe, als wesentlich verstanden, bringt einen in ein wesentliches Verhältnis zur ‚Welt‘, genauer: zum öffentlichen Wesen, - zu seiner Ungestalt und seiner Gestalt, zu seinem Unheil und seinem Heil. Die Ehe, als die entscheidende Verbindung eines Menschen mit dem Andern, versetzt in die Konfrontation mit dem öffentlichen Wesen und seinem Schicksal, – ausweichen kann ihr der Mensch in der Ehe nicht mehr, er kann nur noch sich darin bewähren oder darin versagen. Die vereinzelte Person, ehelos oder nur fiktiv verehelicht, kann sich isoliert erhalten, die Ehe-‚Gemeinschaft‘ ist Teil der großen Gemeinschaft, mit ihrer eigenen Problematik in die allgemeine gefügt, mit ihrer Heilshoffnung an die des großen Wesens gebunden, das in seinem unseligsten Zustand die Menge heißt. Wer „eine Ehe eingegangen ist“, wer in die Ehe eingegangen ist, hat in der Intention des sacramentum damit Ernst gemacht, daß der Andre i st: daß ich am Seienden nicht rechtmäßig teilnehmen kann, ohne am Sein des Andern teilzunehmen; daß ich auf die lebenslange Anrede Gottes an mich nicht antworten kann ohne für den Andern mitzuantworten; daß ich mich nicht verantworten kann ohne den Andern mit zu verantworten, als der mir anvertraut ist. Damit aber ist der Mensch entscheidend in das Verhältnis zur Anderheit getreten; und das (…) ist das öffentliche Wesen. Daran, darein will die Ehe uns führen. Kirkegaard läßt selber einmal einen seiner Pseudonymen, den „Ehemann“ der „Stadien“, dergleichen aussprechen, (…) Die Ehe ist die exemplarische Bindung, sie trägt uns wie keine andre in die große Gebundenheit, und nur als Gebundene können wir in die Freiheit der Kinder Gottes gelangen.> (S. 232/233) Natürlich ist es mit diesem ‚öffentlichen Wesen‘ problematisch. Kirkegaard sieht hier „Die Menge“ ihr Unheil verrichten, als die kompakte Teufelei. Buber stellt das auch in eigenen Worten ziemlich gut dar, aber er sieht hier eine falsche Vereindeutigung bei Kirkegaard am Werk: <Dieser für das Denken unsrer Zeit in wachsendem Maße folgenreichen Verwechslung ist mit der Kraft der Unterscheidung entgegenzutreten.> (S. 237) ‚Menge‘ (wir würden heute eher das Wort ‚Masse‘ oder den Ausdruck ‚Massenmensch‘ bevorzugen) ist nach Buber nicht vollständig identisch mit dem ‚öffentlichen Wesen‘: <Ganz anders der Mensch, der mit dem öffentlichen Wesen lebt. Das ist nicht Bündelung sondern Verbindung. Er ist jenem verbunden, angelobt, angetraut, also dessen Schicksal miterleidend, vielmehr: es erleidend, stets es zu erleiden willens und bereit, aber sich keiner der Bewegungen dieses Wesens blind überlassend, vielmehr jeder gegenüber wach und sorgend, daß sie die Wahrheit und die Treue nicht verfehle. (…) Ists Menge, entscheidungsfremde, entscheidungswidrige Menge, was ihn umwimmelt, er nimmt sie nicht hin: an dem Ort, wo er steht, erhöht oder unscheinbar, mit den Kräften, die er besitzt, (…) tut er das Seine, um die Menge zu entmengen.> (S. 237/238) Das ist natürlich eine sehr interessante und wichtige Unterscheidung. Allerdings ist es so, dass diese ‚Menge‘, also beispielsweise die Spießer-Mehrheit in Deutschland, alles dransetzt, Glauben zu machen, dass einzig sie das ‚öffentliche Wesen‘ verkörpert und Kritiker im Sinne von Buber wären sodann ‚Außenseiter‘, und wenn diese sich noch so sehr für die Vernunft oder das Gemeinwohl oder die Verfassung einsetzen. <der Einzelne, der seinem Glaubensverhältnis lebt, muß es in den unverkürzten Maßen seines gelebten Lebens sich erfüllen lassen wollen. Der Stunde, die ihn antritt, der biographischen und geschichtlichen Stunde, muß er, so wie sie ist, mit ihrem ganzen Weltgehalt, mit all ihrem Widerspruch, der wie Widersinn anmutet, standhalten, ohne die Wucht der Anderheit in ihr abzuschwächen. Die Botschaft, die an ihn von dieser Stunde her, in der Erscheinung dieser Situation ergeht, muß er unbeschönigt, unveredelt vernehmen;> (S. 240) <Die menschliche Person gehört, ob sie es wahrhaben, ob sie damit ernstmachen will oder nicht, der Gemeinschaft zu, in die sie geboren oder geraten ist.> (S. 241) <Es ist offenbar, daß für den in der Gemeinschaft lebenden Menschen der Boden der personhaften Wesensentscheidung von dem Faktum der sogenannten Kollektiventscheidungen dauernd bedroht ist. Ich erinnere an Kirkegaards Warnung: „Menge gewährt entweder völlige Reuelosigkeit oder Unverantwortlichkeit oder schwächt doch die Verantwortung für den Einzelnen dadurch, daß sie diese zur Größe eines Bruchs herabsetzt.“> (S. 242) <Unter politischer Entscheidung versteht man heute im allgemeinen den Anschluß an eine solche Gruppe. Ist dieser erfolgt, dann ist alles endgültig geordnet, die Zeit des Sichentscheidens ist vorüber. Man braucht fortan nichts anderes zu tun als die Bewegungen der Gruppe mitzumachen. Nie mehr steht man am Kreuzweg, nie mehr hat man unter den möglichen Handlungen die rechte zu erwählen, es ist entschieden. (…) Die Gruppe hat einem seine politische Verantwortung abgenommen.> (S. 243) <Ich worte meine Antwort, indem ich unter den möglichen Handlungen die vollziehe, die meiner hingegebenen Einsicht als die rechte erscheint. Mit meiner Wahl, Entscheidung, Handlung – Tun oder Lassen, Eingreifen oder Anhalten – antworte ich, wie unzulänglich auch, dennoch rechtmäßig dem Wort [das durch die Situation an mich gerichtet war], verantworte ich meine Stunde. Diese Verantwortung kann mir meine Gruppe nicht abnehmen, ich darf sie mir von ihr nicht abnehmen lassen, sonst verkehre ich mein Glaubensverhältnis, sonst schneide ich aus Gottes Machtbereich den Bereich meiner Gruppe zurecht.> (S. 144/145) <Ich sage also, daß der Einzelne, das heißt der verantwortlich Lebende, auch seine politischen Entscheidungen jeweils nur von jenem Grunde seines Daseins, an dem er des Geschehens als der göttlichen Rede an ihm inne wird, rechtmäßig vollziehen kann, und daß er, wenn er diese Gewärtigkeit des Grundes sich von seiner Gruppe abschnüren läßt, Gott die aktuale Erwiderung verweigert.> (S. 147) <Was jeweils das Rechte ist, kann keine der heute bestehenden Gruppen anders erfahren als dass Menschen, die ihr angehören, die eigene Seele dransetzen es zu erfahren und es sodann, sei es noch so bitter, den Gefährten eröffnen – schonend, wenn es sein darf, grausam, wenn es sein muß. In dieses Feuerbad taucht die Gruppe Mal um Mal oder sie stirbt den inneren Tod.> (S. 148) Bei diesen Sätzen denke ich sofort an Thilo Sarrazin und seine SPD. Bing: Die SPD versuchte mehrfach, Sarrazin aus der Partei auszuschließen, da seine Ansichten als nicht mit den Grundsätzen der Partei vereinbar angesehen wurden. Schließlich wurde er 2020 nach einem dritten Parteiordnungsverfahren aus der SPD ausgeschlossen. Thilo Sarrazin äußerte in seinem Buch "Deutschland schafft sich ab" und in verschiedenen Interviews kontroverse Ansichten, die zu seinem Ausschluss aus der SPD führten. Einwanderung und Integration: Sarrazin behauptete, dass die Integration von Einwanderern, insbesondere aus muslimischen Ländern, in Deutschland gescheitert sei. Er argumentierte, dass diese Gruppen weniger bereit seien, sich zu integrieren, und dass dies langfristig negative Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft habe. _____________________________
<Gehen wir von dem als ganzes Wesen, mit der Gesamtheit seines Wesens erkennen wollenden Einzelnen aus, so finden wir, daß die Kraft seines Verlangens nach der Wahrheit die ‚ideologischen‘ Bande seines sozialen Soseins an entscheidenden Punkten sprengen kann. Der ‚existentiell‘ denkende, das heißt in seinem Denken sein Leben einsetzende Mensch bringt in sein Realverhältnis zur Wahrheit nicht bloß seine Bedingtheiten, sondern auch die sie transzendierende Unbedingtheit seiner Suche, seines Griffs, seines unbändigen, die ganze Bewährungsmacht der Person mitreißenden Wahrheitswillen ein.> (S. 265) Das ist bezogen auf die (fast alles Geistige umfassende) Ideologietheorie von Karl Mannheim, die „Wissenssoziologie“. Was mir bei diesem Text als Assoziation einfällt, ist ein bedeutendes Kunstwerk, nämlich das Musikstück von Karat - Albatros – da werden die Bande der Unfreiheit gesprengt – was sicherlich eine enge Verwandschaft mit dem Sprengen der ideologischen Bande der Wahrheit hat. _______________________________________
Das 4. Kapitel vor dem Nachwort (S. 271 bis 298) hat den Titel „Elemente des Zwischenmenschlichen“ (1953)
<Der Mensch ist nicht in seiner Isolierung, sondern in der Vollständigkeit der Beziehung zwischen dem einen und dem andern anthropologisch existent: erst die Wechselwirkung ermöglicht, das Menschentum zulänglich zu erfassen.> (S. 290) <Die erschließende Funktion zwischen den Menschen, die Hilfe zum Werden des Menschen als Selbst, das Einander-Beistehn zur Selbstverwirklichung des schöpfungsgerechten Menschentums ist es, das das Zwischenmenschliche zu seiner Höhe führt. Erst in zwei Menschen, von denen jeder, wenn er den andern meint, zugleich das Höchste meint, das eben diesem zubestimmt ist (…)> (S. 291/292) <Im echten Gespräch geschieht die Hinwendung zum Partner in aller Wahrheit, als Hinwendung des Wesens also. Jeder Sprecher meint hier den Partner, an den, oder
die Partner, an die er sich wendet, als diese personhafte Existenz. Jemanden meinen heißt in diesem Zusammenhang zugleich das dem Sprecher in diesem Augenblick mögliche Maß der Vergegenwärtigung üben. (…) Der
Sprecher nimmt aber den ihm so Gegenwärtigen nicht bloß wahr, er nimmt ihn zu seinem Partner an, und das heißt: er bestätigt, soweit Bestätigung an ihm ist, dieses andere Sein. Die wahrhafte Hinwendung seines Wesens
zum andern schließt diese Bestätigung, diese Akzeptation ein. Selbstverständlich bedeutet solch eine Bestätigung keineswegs schon eine Billigung; aber worin immer ich wider den andern bin, ich habe damit, daß ich
ihn als Partner echten Gesprächs annehme, zu ihm als Person Ja gesagt. <Wo aber das Gespräch sich in seinem Wesen erfüllt, zwischen Partnern, die sich einander in Wahrheit zugewandt haben, sich rückhaltlos äußern und vom Scheinenwollen frei sind, vollzieht sich eine denkwürdige, nirgendwo sonst sich einstellende gemeinschaftliche Fruchtbarkeit. Das Wort ersteht Mal um Mal substantiell zwischen den Menschen, die von der Dynamik eines elementaren Mitsammenseins in ihrer Tiefe ergriffen und erschlossen werden. Das Zwischenmenschliche erschließt das sonst Unerschlossene.> (S. 295) <Um die Ostern 1914 trat, aus geistigen Vertretern einiger europäischen Völker zusammengesetzt, ein Kreis zu einer dreitägigen Beratung zusammen, die als Vorsprechung gedacht war. Man wollte gemeinsam erwägen, wie etwa der von allen geahnten Katastrophe vorzubeugen wäre. Ohne daß man etwelche Modalitäten der Aussprache vorweg vereinbart hätte, waren alle Voraussetzungen des echten Gesprächs erfüllt. Von der ersten Stunde an herrschte Unmittelbarkeit zwischen allen, von den manchen einander eben erst kennen gelernt hatten, jeder sprach mit einer unerhörten Rückhaltlosigkeit, und offenbar war nicht ein einziger unter den Teilnehmern dem Scheine hörig.> (S. 295) Über die Problematik des „Scheins“ im Gespräch äußert sich Buber folgendermaßen: <In wem auch noch in der Atmosphäre des echten Gesprächs der Gedanke an die eigene Wirkung als Sprecher des von ihm zu Sprechenden waltet, der wirkt als Zerstörer. Wenn ich statt des zu Sagenden mich anschicke, ein zur Geltung kommendes Ich vernehmen zu lassen, habe ich unwiederbringlich verfehlt, was ich zu sagen gehabt hätte, fehlbehaftet tritt es ins Gespräch, und das Gespräch wird fehlbehaftet. Weil das echte Gespräch eine ontologische Sphäre ist, die sich durch Authentizität des Seins konstituiert, kann jeder Einbruch des Scheins es versehren.> (S. 294/295) ______________________________________
Ich hoffe, dass es mir mit diesen Zitaten gelungen ist, die Grund-Struktur der politischen Ideen des Philosophen Martin Buber darzustellen. Wer meint: „Das hat doch großenteils nix mit Politik zu tun!“, sollte bedenken, dass es Buber um die Haltung eines wahren Menschentums geht – nicht zuletzt als wesentliche Vorausetzung für eine menschliche Politik.
Gießen, 25. Dezember 2024 Manfred Aulbach
|
||