|
|
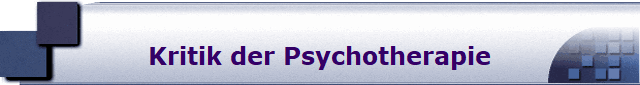 |
||
|
Manfred Aulbach Kommentar zu Petzold / Märtens: Hilarion Petzold, Michael Märtens (Hg.): Therapieschäden. Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie, Mainz 2002 - Zum Stand der Risikendebatte in der Psychotherapie und der psychotherapeutischen Schadensforschung (2002) - Widerstände und Probleme der Auseinandersetzung mit Schäden
[hier speziell der Aufsatz:] Ausblick: Überlegungen, Perspektiven und Konsequenzen
Der Aufsatz behandelt vor allem das Problem der Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapien. Dabei wird als Meta-Rahmen dieser Thematik des öfteren auf grundsätzliche Defizite von Psychotherapie eingegangen. Die Frage, die hier speziell an den Aufsatz gestellt wird bezieht sich auf jenen Meta-Rahmen: Was sind nach Ansicht der Autoren grundsätzliche Defizite von Im folgenden sind 12 Punkte aufgelistet, die einen Überblick darüber geben, was an Kritikpunkten mehr oder minder deutlich von den Autoren aufgeführt wird. In eigenen „Bemerkungen“, die mit „M.A.“ gekennzeichnet sind, kommentiere ich gewisse Ansichten der Autoren.
Folgende Haupt-Defizite sind bei der psychotherapeutischen Profession auszumachen: 1. Spezifische Schwierigkeiten der Selbstwahrnehmung der Psychotherapeuten (S. 424): Die in dem oben angeführten Reader zusammengestellten Arbeiten zeigen deutlich, wie schwierig eine Beschäftigung mit den möglichen Schattenseiten des eigenen professionellen Handelns in der Psychotherapie ist. 2. Psychotherapie als ‚Seelsorge’ (S. 424) im Rahmen der ‚Medizinalmacht’ (S. 427) und Psychotherapie als Lebensorientierung (S. 427 f.) erschweren Kritik: Nämlich dadurch, daß Psychotherapie als Disziplin in die Position einer „säkularen Seelsorge" gekommen ist, als „Nachfolgerin der Seelsorge", mit den PsychoanalytikerInnen/PsychotherapeutInnen als ,.Stand von weltlichen Seelsorgern" (Freud, Pfister 1980, 136). Und wenn Ekklesialmacht und Medizinalmacht als mehr oder weniger verborgene oder nichtbewusste „Dispositive der Macht" (Foucault 1978) im „Phänomen Psychotherapie" zum Tragen kommen, … Und wenn überdies Psychotherapie in der vielbeschworenen „Unübersichtlichkeit der Moderne" von nicht wenigen Menschen auch die Funktion einer „Orientierung gebenden Disziplin" zugeschrieben bekommt, dann wird eine Infragestellung der Rolle der Therapie und der Richtigkeit ihrer offen oder verdeckt vorgetragenen Geltungsansprüche schwierig. 2.a. Das ‚Beichtsetting’ hat als implizite Voraussetzung die ‚Schuld’ des Beichtenden (S. 424): Nun liegt es in der Struktur der Beichtsettings, dass das Beichtkind zumeist unrecht getan hat. Aus der hier gegebenen impliziten Selbstgefälligkeit des Beichtvaters folgt mangelndes Risikobewußtsein des Beichtvaters. 3. Der ‚Patient’ wird teilweise geistig entmündigt bzw. seine eigene Selbsteinschätzung wird möglicherweise übermäßig ignoriert (S. 425): Der/die PatientIn wird darauf geeicht, seiner Reflexivität zu misstrauen. „Wir verpflichten ihn auf die analytische Grundregel, die künftig sein Verhalten gegen uns beherrschen soll ... gelingt es ihm, nach dieser Anweisung seine Selbstkritik auszuschalten, so liefert er uns eine Fülle von Material, Gedanken, Einfälle ... die uns also in den Stand setzen, das bei ihm verdrängte Unbewusste zu erraten und durch unsere Mitteilung die Kenntnis seines Ich von seinem Unbewussten zu erweitern" (Freud, Bemerkungen über Übertragungsliebe, 1915, S. 413). Anmerkung (M.A.): Ich denke, trotzdem hat Freud hier etwas Wahres erfaßt, nämlich daß der sog. Neurotiker typischerweise Probleme mit einer realistischen Selbstwahrnehmung hat. Ob aber die Couch-Methode Freuds, alle eigenen Selbst-Einschätzungen (beispielsweise Kritik gewisser Vorstellungen) des sog. Patienten beiseitezuräumen, um zum ‚eigentlichen’ Unbewußten vorzudringen, nicht ein freudianischer haltloser Mythos ist und insofern ins Nichts führt – das ist hier die Frage. Vielleicht wären gerade umgekehrt die kritischen Selbsteinschätzungen des ‚Patienten’ und ihre genauere Analyse - z.B. wenn sie unrealistisch oder kurios sind - das, worauf es am meisten ankommt. 3.a. Dem entspricht – und das ist meiner Ansicht nach sehr gut beobachtet seitens der Autoren - ein höchst fragwürdiger Anspruch, was denn das eigentliche Ziel insbesondere der psychoanalytisch orientierten Psychotherapie ist (S. 441): Der Anspruch der Psychoanalyse, durch ihre Behandlung Strukturveränderungen der Persönlichkeit bewirken zu wollen (und zu können) - und ein solcher Anspruch wird z.B. von der Verhaltenstherapie und der wissenschaftlichen Gesprächstherapie nicht geteilt - muss nicht nur strittig im Diskurs zwischen den Therapierichtungen diskutiert werden, sondern auch unter grund- bzw. verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten auf der Ebene politischer Entscheidungsbildung. Denn ein solcher Anspruch scheint uns mit Blick auf den rechtlich hoch angesiedelten Schutz der Persönlichkeit sehr problematisch, geht es doch nicht um die Modifikation eines Verhaltens oder dysfunktionaler Attributionen und Kontrollüberzeugungen oder die Veränderung von Awareness und Stilen des Kontaktes, sondern um weit reichende Strukturveränderungen der Persönlichkeit. 4. Psychotherapie hat die Perspektive des Herrschaftswissens (Urteilen & Richten) mit der dialektischen Gegenposition von prinzipiellem Unwissen und struktureller Machtlosigkeit auf seiten des Therapierten, wobei die Psychotherapie (S. 425): sich gegen Kritik durch „Widerstandsinterpretationen" immunisiert. 5. Das Seelsorger-Paradigma impliziert offenbar, daß die Psychotherapie (S. 426): beansprucht, den „rechten Weg" der „Seelenführung" zu besitzen - und viele Therapieschulen und TherapeutInnen haben diesen Anspruch. Anmerkung (M.A.): Man sieht hier deutlich eine Nähe zu Priestertum statt zu einer konkreten ‘handwerklichen’ Praxis - etwa reale Kommunikationsprobleme genau zu analysieren und zu bearbeiten. 5.a. Daraus folgt für die Autoren – meines Ermessens durchaus logisch - ein Hang zur Selbstgefälligkeit der Psychotherapeuten (S. 426): denn dann ist es schwer, dass Zweifel an der Sinnhaftigkeit, Rechtmäßigkeit und Richtigkeit des eigenen Tuns aufkommen können oder ihm gar das Potenzial von Risiken oder Schäden zugeschrieben werden kann. 6. Üblicherweise wird angenommen, daß die Gefährdung des Patienten darin liegt, daß Therapeuten die ‚Kunst’ nicht richtig beherrschen (S. 426 f.). Die Frage ist nur: Wer definiert Kompetenz nach welchen Kriterien? Deklarationen - von wem auch immer im Brustton der Überzeugung vorgetragen -, Psychotherapie sei „richtig und kompetent angewandt", nicht schädlich, haben keinen soliden Boden. Wichtig sei eine offene Haltung gegenüber der Fragestellung möglicher Risiken (S. 427): Wie können solche Risiken gemindert werden, ist da zu fragen? Aus dem hier entfalteten Kontext kann gesagt werden: a. Dadurch, dass die „community of psychotherapists" eine Bewusstheit für diese Problematik schaffen will und schafft, b. dass Konsequenzen aus der Bewusstheit über diese Problematik gezogen werden, z.B. dadurch c. dass der einzelne Therapeut/die einzelne Therapeutin ihre eigene Haltung zu diesen Fragen kritisch reflektiert und vermeintliche Sicherheiten zu verändern bereit ist und d. dass die Patientlnnen als mündige und verantwortliche GesprächspartnerInnen in der Bearbeitung dieser Problematik beteiligt werden. Anmerkung (M.A.): Der letztere Punkt (d.) erscheint mir von eminenter Wichtigkeit, da dies ja die eigentliche Kontrollinstanz für jede Therapie darstellt: wie sieht der behandelte ‚Patient’ den Erfolg der therapeutischen Bemühungen. Die Ignoranz dieses Punktes, beispielsweise, dem Patienten hier ‚Widerstand’ gegen Heilung zu unterstellen, weil er kritisch gegenüber den bisherigen Behandlungen geworden ist, halte ich für ziemlich fatal, da diese Sichtweise des Therapeuten stark an Kritikimmunisierung – im Sinne des Kritischen Rationalismus (Albert, Popper) – grenzt, also möglicherweise allzusehr die geistige Beschränktheit des Therapeuten selber reflektiert. 7. Zweifelhafte Annahmen über die Menschennatur (S. 428): die von keinen Selbstzweifeln geplagten Annahmen über die Richtigkeit von - doch zum Teil weit greifenden - Geltungsbehauptungen über die Menschennatur, welche eigentlich Ideologeme sind, und kaum einmal als solche deklariert werden oder zumindest als Hypothesen, … Anmerkung (M.A.): Gemeint sein könnte hier meines Ermessens vor allem Freuds biologistische Annahmen über ‚Triebe’ (beispielsweise ‚Eros’- und ‚Todestrieb’) als Erklärung des menschlichen Verhaltens und die Dominanz der ‚Sexualtriebes’ (in seinen angeblich verschiedenen Formen, oral, anal, genital) in der Individualentwicklung. Speziell dann auch die dogmatische Behauptung eines inzestuösen ‚Ödipuskomplexes’ als notwendiges Durchgangsstadium in der Entwicklung des ‚Knaben’. – Aber vermutlich aus ‚Gleichgewichtsgesichtspunkten’ wollen die Autoren auch die humanistische Psychologie von Carl Rogers (vgl. zu Rogers die instruktive Website www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm) ebenfalls miteinbeziehen in diesen Ideologemverdacht (S. 441): In jedem Fall bleibt die Frage zu diskutieren, was die kulturpessimistische Ausrichtung des Freudianismus und sein negativ getöntes Menschenbild oder die kulturoptimistische Ausrichtung von Carl Rogers und seine anthropologische Idealisierung des „guten Menschen" für Auswirkungen auf Behandlungstheorien und -praxen haben und welche Risiken damit verbunden sind. Solcher Ideen-Gehalt (und sein Kultur- und geistesgeschichtlicher Hintergrund, vgl. Foucault 1988) geht zweifelsohne in therapeutische Geltungsbehauptungen und Strategien ein, die doch aus übergeordneten Perspektiven betrachtet und reflektiert werden müssen, d.h. nicht allein Gegenstand autonomer Diskurse therapeutischer Schulen bleiben dürfen. 8. Allgemeine Tendenz zur geistigen bzw. theoretischen Abschottung seitens diverser psychotherapeutischer Schulen. (S. 430) Eine solche Einstellung ist als eine „wissenschaftliche" sicherlich nicht haltbar und lässt eine Hybris oder eine souveräne Unkenntnis deutlich werden, jeweils verbunden mit der Abwertung anderer Positionen (Petzold, Sieper 2001 d), die in einem eigenartigen Spannungsverhältnis zu oft ebenfalls geäußerten Gefühlen der Hilflosigkeit stehen, die von TherapeutInnen verbalisiert werden, wenn sich KlientInnen nicht verändern. In weiten Bereichen des psychotherapeutischen Feldes - und das kommt auch in Beiträgen dieses Bandes immer wieder zum Ausdruck - sind die Diskussionen um negative Effekte im theoretischen Konzept der eigenen Therapietheorie gefangen. Schulenübergreifende Diskurse, disziplinübergreifende gar, sind selten. In den rechtfertigenden Darstellungen, die man in der Literatur häufig findet (vgl. die Grawe-Debatte), werden Außenperspektiven und Kritiken zu wenig und kaum als Chancen des Erkenntnisgewinns zur Kenntnis genommen und noch weniger als ein Impuls, sich ernsthaft infrage zu stellen. Man argumentiert nach dem erwähnten Muster im Sinne einer Umdeutung: exkulpierend - die Methode wurde unzureichend oder falsch oder unautorisiert und deshalb mangelhaft angewendet – dann apologetisch: die unerwünschten Wirkungen seien letztendlich geradezu ein Beleg für die Richtigkeit und Überlegenheit des eigenen Ansatzes, weil sie die Unverzichtbarkeit der korrekten Anwendung „lege artis" demonstrieren - welche korrekte Anwendung? … die von Freud oder von Winnicott, die von Lacan oder Kohut, die von Skinner oder Meichenbaum, die von Wolpe oder Kanfer, die der organismustheoretischen Fritz-Perlschen Gestalttherapie oder die der Buberschen? [zur letztgenannten Inkompatibilität vgl. Petzold 2000e]. Wegen des „lege-artis-argumentes" wird meistens weniger von Nebenwirkungen, sondern hauptsächlich von Misserfolgen gesprochen (z.B. Kächele 1984, Fischer-Klepsch, Münchau & Hand 2000, Reinecker 1996, 43-44). Zu denken, dass Misserfolge oder mäßige Erfolge (etwa von Langzeitpsychoanalysen) auftreten, weil die Grundprinzipien konsequent befolgt wurden, scheint jenseits des Vorstellbaren oder des Vorstellungswillens zu liegen. 9. Dissidentenbildung (S. 431): Damit bleiben auch alle Entwicklungshorizonte geschlossen, was vielleicht erklärt (neben dem Tabu, an den Grundgedanken der Gründerväter zu rühren), dass bei vielen psychotherapeutischen Verfahren (der klassischen Psychoanalyse und ihren Varianten, der klassischen Gestalttherapie mit ihren Varianten, dem Psychodrama, der Transaktionsanalyse etc.) seit Abfassung ihrer Basisschriften es kaum zu wirklichen makro- oder mesoparadigmatischen Überschreitungen gekommen ist, und wo dies der Fall war, kam es zu Spaltungen, weil der Großteil der Community die Überschreitung nicht mitvollziehen konnte und noch nicht einmal tolerant der anderen Sicht gegenüber sein wollte. Dadurch wurden Phänomene der „Dissidenz" produziert. Man spricht wie in Religionsgemeinschaften von den „DissidentInnen". M.a.W. man ist in vielen Fällen nicht offen gegen andere Therapieverfahren sondern dogmatisch eingegrenzt auf eine bestimmte ‚Linie’. 10. Risiken der Psychotherapie: Die Autoren erwähnen folgende Risiken, die „während“ oder sogar „von der Behandlung“ als Exacerbation [action that makes a problem or a disease (or its symptoms) worse] „ausgelöst werden kann“ (S. 432): z. B. eine schwere depressive Reaktion bis hin zu Arbeitsunfähigkeit und Suizidalität, eine psychotische Dekompensation, psychosomatische und psychische Reaktionsbildungen etc., von all diesen möglichen Zwischenfällen weiß man eigentlich nur wenig Gesichertes. Hier mehr zu wissen - diagnostisch und interventiv, forschungsgestützt versteht sich, wäre dringend erforderlich nebst der Entwicklung effektiver Handlungsroutinen. Es liegen auch noch keine praktischen Modelle der Informationsvermittlung vor, wie man Patientlnnen wohl am besten eine solche Risikoaufklärung gibt, ohne sie zu verschrecken. Auch hier ist Praxisforschung angesagt. Anmerkung (M.A.): Im Grunde tut sich hier meines Ermessens der Abgrund der Psychotherapie auf, vor dem Karl Kraus sein Menetekel hat erscheinen lassen: „Die Psychoanalyse ist die Krankheit, die sie zu heilen vorgibt.“ Denn wenn der ‚Patient’ seine Rolle als psychisch kranker ‚Patient’ (als ‚Gestörter’) einmal übernommen hat, gibt ihm das – gemäß der üblichen gesellschaftlichen Vorstellungen – sicherlich keine positiven Selbstvorstellungen - sondern ganz im Gegenteil. Es kann gut sein, daß nunmehr ein erheblicher Neu-Anteil seiner Problemstellungen genau daraus resultiert – und weniger aus seinen ursprünglichen Kommunikationsproblemen. (Bzgl. dieser sozialpsychologischen Fragestellung findet man bei den Autoren allerdings keine Überlegung). Desweiteren steckt der ‚psychisch Kranke’ in einem Vicious Circle: Als Kranker ist er krank - und bleibt krank. ‚Gesund’ kann er erst werden, wenn er sich selbst nicht mehr als Kranker definiert bzw. als solcher nicht mehr von außen definiert sieht. Ein interessantes spezifisches Kommunikationsproblem, das dem ‚Patienten’ durch das medizinische Krankheitsmodell für sog. psychische Probleme (als rein individuelle Symptom-Probleme) zusätzlich und ganz wesentlich aufgehalst wird. Der sog. Patient muß sich diesbezüglich vorkommen wie Laokoon:
Antonius Eisenhoit, Laokoon (aus der Metallotheca), Kupferstich, um 1580
El Greco
Jean-Baptiste Tuby (Versailles 1696)
11. In einer Nebenbemerkung der Autoren, die sich mit einem Neuerer der Psychotherapie Grawe befasst, kommt ein weiterer wichtiger Kritikpunkt an der gängigen Psychotherapie zum Vorschein (S. 434): Grawe übersieht bei seiner alleinig „psychologischen" Perspektive, dass eine biopsychosoziale und soziokulturelle Betrachtung angezeigt ist, die Bio- und Naturwissenschaften, Sozial- und Kulturwissenschaften mit ihren Konzepten und Forschungsergebnissen einbezieht (Petzold 2001a). Anmerkung (M.A.): Die Tatsache, daß (in Deutschland) als professionell anerkannte ‚Psychotherapeuten’ in der Regel nur Leute mit einem vorhergehenden Medizin- oder Psychologiestudium zugelassen sind aber keine Sozialwissenschaftler, also soziologisch denkende Menschen, ist meiner Ansicht nach sehr aufschlußreich. Denn es wird hier rein institutionell (und dem Worte nach) schon vorausgesetzt, daß das Unglück der Menschen eine rein individuelle Angelegenheit sei: ein psychisches, seelisches Versagen des Individuums (falls kein rein körperlicher oder genetischer Defekt auszumachen ist). Demgegenüber ist auf den nach wie vor gültigen Aufsatz von Leo Löwenthal in der Zeitschrift für Sozialforschung (hg. von Max Horkheimer, Paris 1936, Heft 3) hinzuweisen: „Das Individuum in der individualistischen Gesellschaft. Bemerkungen über Ibsen“, in welchem zu erkennen ist, daß das Unglück der Menschen eine starke gesellschaftliche Komponente hat. Wenn man dies nicht mitberücksichtigt, so liegt in der Regel eine Verkennung der Realität vor. – Um was geht es aber sonst in der ‚Psychotherapie’ als um ‚unglückliche’ irgendwie ‚verwunschene’ Menschen? Glückliche, oder wenigstens zufriedene, Menschen werden wohl kaum nach einer Psychotherapie Ausschau halten. Auch die Autoren sind sich – zumindest teilweise - dieser sozialen Dimension bewußt, wenn sie schreiben (S. 438): Da Menschen in sozialen Netzwerken leben, deren Gesundheit für Gesundsein oder -werden unverzichtbar ist und deren destruktive Qualität ein hohes pathogenes oder gesundheitsverhinderndes Potenzial hat, kann es nicht darum gehen, nur eine „Einzeltherapie" zu machen, man arbeitet immer mehr oder weniger direkt oder indirekt mit einem sozialen System, dem Netzwerk (Hass, Petzold 1999), und wo das nicht geschieht, entstehen Risiken und können Nebenwirkungen auftreten - für die PatientInnen und auch für Netzwerkmitglieder (z.B. Partner, Kinder). Diese Risikodimensionen sind von den so genannten „einzeltherapeutischen" Verfahren in der Regel noch gar nicht ausreichend gesehen worden, geschweige denn, dass sie hierfür Interventionsformen entwickelt hätten oder zumindest in ausreichendem Maße die Kooperationen mit Familien- oder NetzwerktherapeutInnen suchen würden. Die Ablehnung der Familientherapie als „wissenschaftlich anerkanntes" Verfahren durch den wissenschaftlichen Beirat (d.h. de facto durch die Richtlinienverfahren) zeigt, dass eine eingeengte, schalendeterminierte Sicht oder ein zu eng gefasstes Verständnis von Psychotherapie und Psychotherapieforschung durchaus zu Risiken beitragen kann, weil damit eine bei bestimmten Problemen risikomindernde Methode aus dem System der Hilfeleistung ausgegrenzt wird. In diesem Zusammenhang hervorzuheben ist die positive Vorreiterrolle der ‚Familientherapie’, da sie die borniert individualistische Haltung der klassischen Psychoanalyse überwindet. Die Autoren bringen das ziemlich klar zum Ausdruck (S. 438 f.): Freud vertritt, es sei „dem Patienten anzuraten, dass er seine analytische Kur als eine Angelegenheit zwischen seinem Arzte und ihm selbst behandle und alle anderen Personen, mögen sie ihm noch so nahe stehen oder noch so neugierig sein, von der Mitwisserschaft ausschließe . In späteren Stadien der Behandlung ist der Patient solchen Versuchungen nicht unterworfen" - er ist dann, so kann man es sehen, genug in folgsame Abhängigkeit geraten (Zur Einleitung der Behandlung 1913, 1975 S.196, unsere Hervorhebungen). „Versuchung", „Mitwisserschaft", „ausschließen", so wird eine Geheimniszone aufgebaut, die den Patienten/die Patientin von seinen/ihren nächsten Menschen isoliert (was deren Misstrauen und Widerstand schüren muss). So kann Freud das soziale Netzwerk, das Gespräch zwischen Freunden nur als negativ sehen: „Die Kur hat dann ein Leck, durch das gerade das Beste verrinnt" (a.a.O., S.196). „Bei der psychoanalytischen Behandlung ist die Dazwischenkunft der Angehörigen geradezu eine Gefahr ... Den Angehörigen des Patienten kann man durch keinerlei Aufklärung beikommen ..." (Vorlesungen 1916/17, a.a.O., S.441ff). Zur Revision oder zumindest Relativierung einer solchen dysfunktionalen Haltung hat für weite Bereiche der Psychoanalyse (keineswegs für das gesamte Feld) die Familientherapie beigetragen. Hier liegt ein gutes Beispiel dafür vor, dass ein „Lernen voneinander" zwischen den Schulen beginnen kann. 12. Ein zentraler Punkt der Kritik an objektiv falsch gehandhabter Psychotherapie ist - nach offenbar gut fundierter Ansicht der Autoren - die Ignoranz der Wichtigkeit der Art der Beziehung zwischen Therapeut und Klient (S. 442 f.): Der/die TherapeutIn als Risikofaktor stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Bedeutung der Klient-Therapeut- oder Berater -Therapeut-Beziehung wird in den Forschungsergebnissen immer wieder als zentraler Wirkfaktor herausgestellt (z.B. Grawe, Donati und Bernauer 1994, Grawe 1998, Zimmer 1983, Hentschel et al. 1992). In der Vanderbilt-Studie (Henry et.al 1993, Strupp 1993) zeigte sich, dass auch in Langzeitpsychoanalysen schon die ersten drei Stunden relativ gute Vorhersagen über positive und negative Therapieausgänge ermöglichen, wenn man hierzu die Beziehung zwischen BeraterIn und KlientIn als Indikator verwendet. In einer eigenen Untersuchung (Bäcker 2000; Petzold, Hass, Märtens, Steffan 2000) ermöglichte der eingesetzte Stundenbogen schon nach der ersten, spätestens aber nach der dritten Stunde eine hochsignifikante Vorhersage für das Gelingen der Therapie. Neil Jacobson (1997) wies darauf hin, dass in Paartherapien ähnlich zuverlässige Vorhersagen auch schon auf Grund der Beobachtungen in den ersten 15 Minuten von Paarberatungen angestellt werden können, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Qualität der Beziehung zwischen Beraterln und Klientln relativ schnell und leider auch mit einer ausgeprägten Stabilität etabliert. Demgemäß kommen die Autoren zu folgenden plausiblen Schlussfolgerungen (S. 443): Die behandlungstechnischen Konsequenzen aus diesen Befunden müssen in der Tat erheblich sein. Obwohl die Initiative zum Abbruch der Beziehung zu der Beraterin/dem Berater meist von der Klientin/dem Klienten ausgeht - was in den meisten Fällen sicherlich auch gut ist - sollte eigentlich die Initiative zur rechtzeitigen Beendigung vom Berater/von der Beraterin oder Therapeuten/Therapeutin ausgehen, wenn keine gute „Passung" erreicht werden kann, da dieser viel besser als seine KlientInnen die besondere Bedeutung der therapeutischen Beziehung einschätzen können sollte. Auf Grund seiner Erfahrungen und seiner Ausbildung müsste er sehen, ob eine Beziehung tragfähig und produktiv genug ist, um zu einem guten und für beide Seiten befriedigenden Ergebnis zu führen. Die Psychotherapierichtlinien, die Qualität und Patientensicherheit zu gewährleisten beanspruchen, berücksichtigen diese Risikofaktoren „schlechter Passung" nicht, ja schränken eine solche Berücksichtigung geradezu durch abwicklungstechnische Schwierigkeiten ein. Da die Person der Therapeutin/des Therapeuten ein wesentlicher Wirkfaktor ist, müssen diese Effekte auch hinsichtlich schädigender Effekte dringend weiter untersucht werden, damit gezielt KlientInnen mit bestimmten Störungen nicht durch ungünstige Persönlichkeitsmerkmale von TherapeutInnen gefährdet werden.
__________________________________________
Siehe auch den Artikel in meinem ‘Reflexionsjournal’: Psychotherapie in ihrer modernen Hauptfunktion als ideologisch notwendige Quacksalberei
|
||


